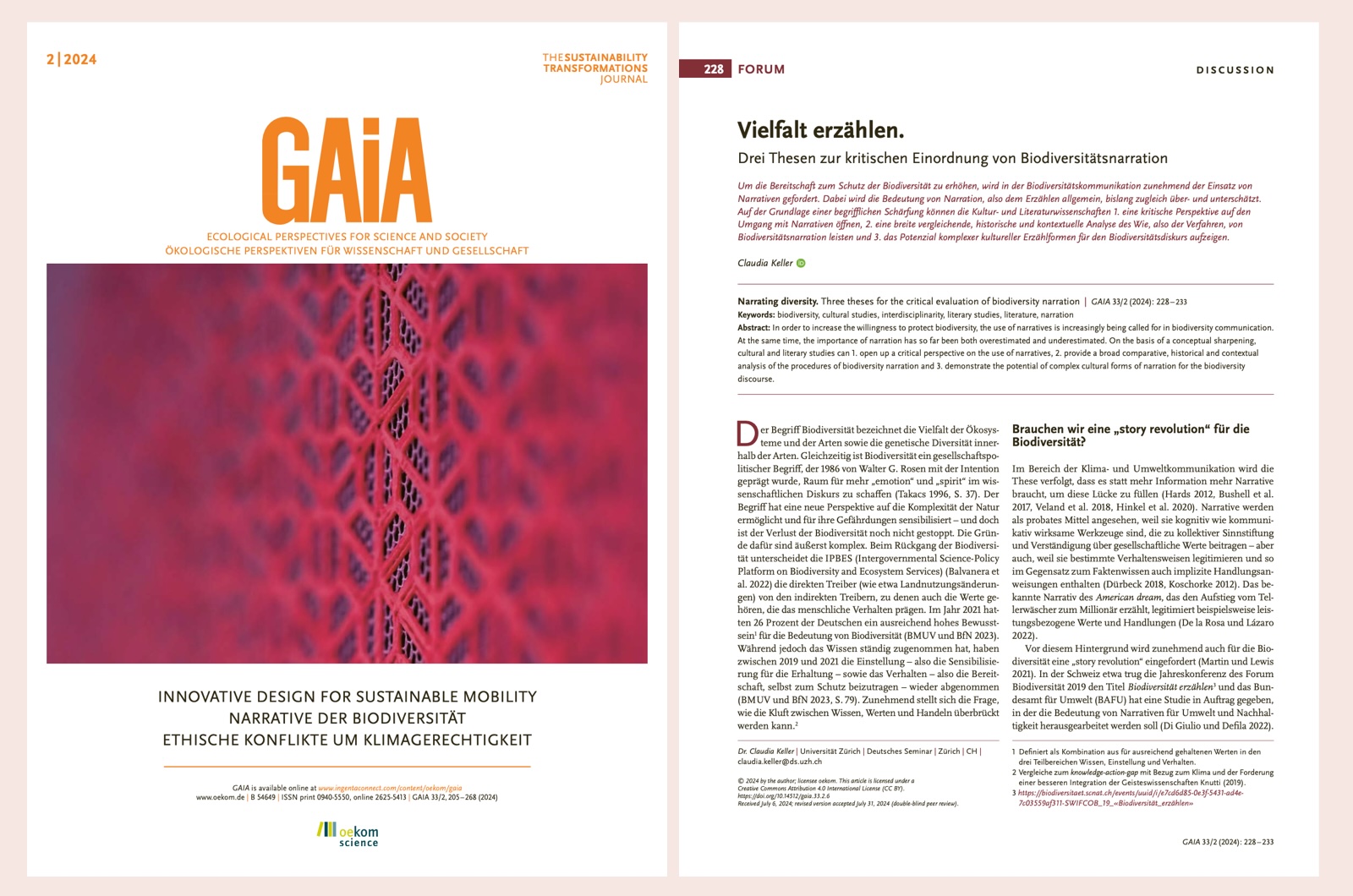Biodiversitätsnarrative
Biodiversitäts-narrative
Von 2026-2030 leite ich das vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) als Starting Grant geförderte Projekt „Narrating Variety. Biodiversity as Paradigm of Transformation in Science and Literature“. Mein Team und ich sind am Environmental Sciences and Humanities Institute der Universität Fribourg angesiedelt.
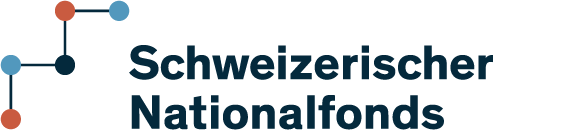
Aktuelles
14.-19. Juni 2026
Am nächsten World Biodiversity Forum in Davos organisiere ich eine Session zur Bedeutung von Umweltnarrativen.
13. März 2026
Ich habe zwei Doktorierenden-Stellen in meinem Projekt zu Biodiversitätsnarrativen zu vergeben mit Bewerbungsschluss Mitte März. Mehr Infos hier.
23. Januar 2026
An der SWIFCOB "Zukunft der Biodiversität Schweiz" leite ich zusammen mit Roger Keller einen Workshop zum Thema Werte und Wahrnehmung von Biodiversität.
1. Januar 2026
Start des Forschungsprojekts „Narrating Variety. Biodiversity as Paradigm of Transformation in Science and Literature“ an der Universität Fribourg.
Das Projekt
Die Biodiversitätskrise ist eine der zentralen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart. Ihr Schutz erfordert nicht nur politische Maßnahmen, sondern auch tiefgreifende kulturelle Veränderungen, da Werte und Weltbilder das Verhältnis von Gesellschaft und Natur wesentlich prägen. Narrative spielen hierbei eine wichtige Rolle, da sie diese Weltanschauungen und Glaubenssätze prägen und mitgestalten können. Neben der Vermittlung von Wissen und Fakten ist die kritische Reflexion solcher Narrative von zentraler Bedeutung, um die ökologischen Krisen zu adressieren.
Während in den Umwelt- und Klimawissenschaften interdisziplinär zu Narrativen geforscht wird, fehlen jedoch in der Biodiversitätsforschung bislang literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze weitgehend. Hier setzt das Projekt an: Es untersucht erstmals systematisch, wie Biodiversität in Wissenschaft, Politik und Kultur – insbesondere der Literatur – erzählt, dargestellt und gerechtfertigt wird. Daraus werden in einem zweiten Schritt Erkenntnisse für die zukünftige Biodiversitätskommunikation abgeleitet.
Das Projekt ist in den Environmental Humanities und der Literaturwissenschaft verortet und konzentriert sich auf den deutschsprachigen, insbesondere Schweizer Kontext. Es setzt auf drei Ebenen an:
- Zuerst wird ein theoretischer Rahmen entwickelt, der eine kultur- und literaturwissenschaftliche Perspektive auf den Biodiversitätsdiskurs ermöglicht.
- Zwei Dissertationen untersuchen sodann die Narrative und Erzählungen über Biodiversität im wissenschaftlichen und politischen sowie im kulturellen Bereich. Das erste Projekt fokussiert auf die Darstellung von Biodiversität; das Zweite analysiert, wie der Schutz von Biodiversität gerechtfertigt wird.
- Auf Basis der Forschungsergebnisse entsteht zuletzt ein Modell für Biodiversitätskommunikation, das für die Praxis in der Schweiz nutzbar gemacht wird.
Die zentrale Fragestellung ist, wie Biodiversität durch Erzählungen Wert erhält – nicht nur im instrumentellen oder ethischen Sinn, sondern auch durch ästhetische und affektive Dimensionen. Analysiert werden dafür Narrative und Erzählungen in zwei Feldern: Im Bereich der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sowie im Bereich der Literatur und Kultur. Die Ergebnisse in diesen unterschiedlichen diskursiven Feldern werden systematisch miteinander verglichen, um herauszuarbeiten, welche Werte durch die jeweils unterschiedlichen Repräsentations- und Legitimerungsformen sichtbar werden.
Das Ziel ist es erstens, den stark von den Naturwissenschaften geprägten Biodiversitätsdiskurs durch kulturelle Perspektiven zu ergänzen. Insbesondere soll es durch die vergleichende Analyse der unterschiedlichen Narrative möglich werden, die Narrative und Erzählungen aus dem kulturellen Bereich, die oftmals andere Werte und Standpunkte verkörpern, stärker in den Biodiversitätsdiskurs zu integrieren.
Dieses Potenzial soll, so das zweite Ziel, dazu genutzt werden, um zu einer Verbesserung der Biodiversitätskommunikation beizutragen. Dazu erarbeitet das Projekt einen soliden theoretischen Rahmen für die Verwendung von Narrativen in der Biodiversitätskommunikation, validiert diesen mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen und übersetzt diese in konkrete Leitlinien, die in der Praxis – etwa in Kommunikation, Bildung und Politikberatung – anwendbar sind. So leistet das Projekt einen Beitrag dazu, den Schutz der Biodiversität auch als kulturelle Aufgabe zu verstehen und im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern.
Narrative und die Wirkung der Sprache.
Webinar in der Reihe Kommunikation rund um Biodiversität, 26. März 2026.
Team
Prof. Dr. Claudia Keller
Neben meiner Forschung koordiniere ich das Gesamtprojekt – ich betreue die beiden Doktorierenden sowie die studentische Hilfskraft, pflege den Austausch mit den Kooperationspartner:innen, bündle unsere Erkenntnisse und mache unsere Ergebnisse öffentlich zugänglich.
Zwei Doktorierende und eine Hilfsassistenz werden im Verlauf des Jahres 2026 angestellt.

Kooperationen
Prof. Dr. Florian Altermatt, Universität Zürich/Eawag
Prof. Dr. Sven Bacher, Universität Fribourg
Prof. Dr. Christine Bichsel, Universität Fribourg
Prof. Dr. Roland Borgards, Universität Frankfurt/M.
Prof. Dr. Elizabeth Callaway, University of Utah
Dr. Anna Deplazes Zemp, Universität Zürich
Dr. Manuela Di Giulio, NaturUmweltWissen
Prof. Dr. Gabriele Dürbeck, Universität Vechta
Prof. Dr. Tom Kindt, Universität Fribourg
PD Dr. Georg Toepfer, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin